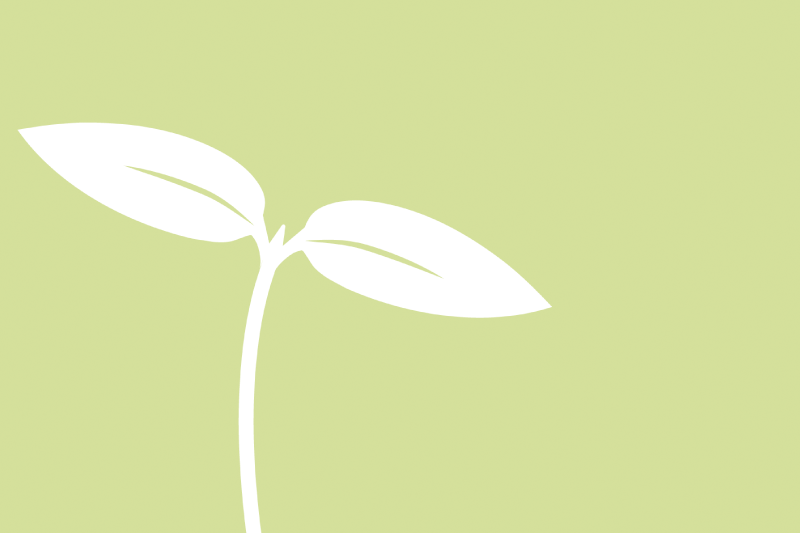Mittelalterliche Pflanzen
Die Epoche des Mittelalters hat mich schon als Kind fasziniert. Allerdings drehte sich damals noch alles um mutige Ritter, steinerne Burgen und fantastische Mythen. In meinem Studium habe ich dann zum ersten mal die Gärten des Mittelalters und die dort verwendeten Pflanzen kennen gelernt und war erstaunt, welches ausgeprägte Pflanzenwissen in dieser Zeit bereits vorherrschte und wie wenig von diesem Wissen heute noch (allgemein) bekannt ist.
Daher befasse ich mich seit einigen Jahren mit verschiedensten Quellen, die Informationen zu mittelalterlichen Gärten sowie ihren Pflanzen enthalten. Dazu gehören beispielsweise der „St. Galler Klosterplan“ (um 820 n. Chr.), das Lehrgedicht des Mönches Walahfried Strabo „Liber de cultura hortorum“ (um 840 n. Chr.), die „Physica“ (1150-1160 n. Chr.) von Hildegard von Bingen und die Landgüterverordnung „Capitulare de villis vel curtis imperii“ (um 800 n. Chr.), die im Auftrag des Kaisers Karl der Große verfasst wurde.
Daraus entstand die Idee, dieses alte Wissen wieder erlebbar zu machen und mit der Kultivierung von historischen Pflanzen die Möglichkeit zu bieten, ein Stück mittelalterliche Gartenkultur auferstehen zu lassen. Unter der Bezeichnung „Hortulus“, was soviel wie „kleines Gärtchen“ heißt, findet ihr in unserer Gärtnerei historische Heil- und Küchenkräuter, Färberpflanzen, Symbolpflanzen oder Pflanzen, denen eine magische Wirkung nachgesagt wurde.
Katharina
Katharina
Diese Iris wurde bereits im Mittelalter, u.a. von Hildegard von Bingen als Heilpflanze genutzt. Beim Trocknen entwickelt der Wurzelstock einen süßlichen Geruch . . .
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Der mittelalterliche Gelehrte Albertus Magnus nennt diese heimische Iris Gladiolus aquosus, da sie anders als z.B. Iris germanica oder Iris barbata wasserreiche Standorte bevorzugt.
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Bereits der römische Gelehrte Plinius empfiehlt die Samen des Bergkümmels bei Magenleiden. Im Mittelalter lässt Karl der Große ihn dann in seine capitulare de villis aufnehmen. Die Früchte, die nach einer Mischung aus . . .
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Lorbeer ist zwar frosttollerant jedoch nicht volkommen winterhart. Im Winter stellt man ihn am betsen kühl und nicht ganz dunkel. Sehr dankbar reagiert er auf eine regelmäßige Düngung und einen "mitwachsenden" Topf.
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Der Provence-Lavendel ist eine Kreuzung des Spike- und Echtem Lavendel und vereint die Vorzüge beider Elternteile. Er ist besonders robust und ertragreich. Die sehr langen . . .
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Der Name Leonurus setzt sich aus leon = Löwe und oura = Schwanz zusammen und beschreibt die dichtgedrängten, zottigen Blütenbüschel. Das "Herz" im deutschen Namen bezieht sich . . .
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Diese heimische Kresse wurde bereits im Mittelalter genutzt. Ihre jungen Blätter haben einen würzigen, kresseähnlichen Geschmack und wurden sowohl frisch als auch getrocknet als günstiger Pfefferersatz . . .
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Das auch als "Maggikraut" bezeichnete Gewürz verleiht Suppen, Salaten, sowie Gemüse-, Fleisch- und Fischgerichten eine herzhafte Note. Unverzichtbar im Linseneintopf.
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Bereits in der Antike galt der Blutweiderich als Heilpflanz. Im 16. Jahrhundert nutze man den Saft des Blutweiderichs zum Gerben von Leder, da er einen hohen Gerbstoffgehalt besitzt.
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Im Mittelalter galt der Andorn als Antidot: „Sollten dir Stiefmütter je feindselig bereitetet Gifte mischen in das Geträk [...] so scheucht ein Trank heilkräftigen Andorns [...] die drohende Lebensgefahr“ (W. Strabo).
Lieferzeit: momentan nicht verfügbar
Kategorien
Willkommen zurück!